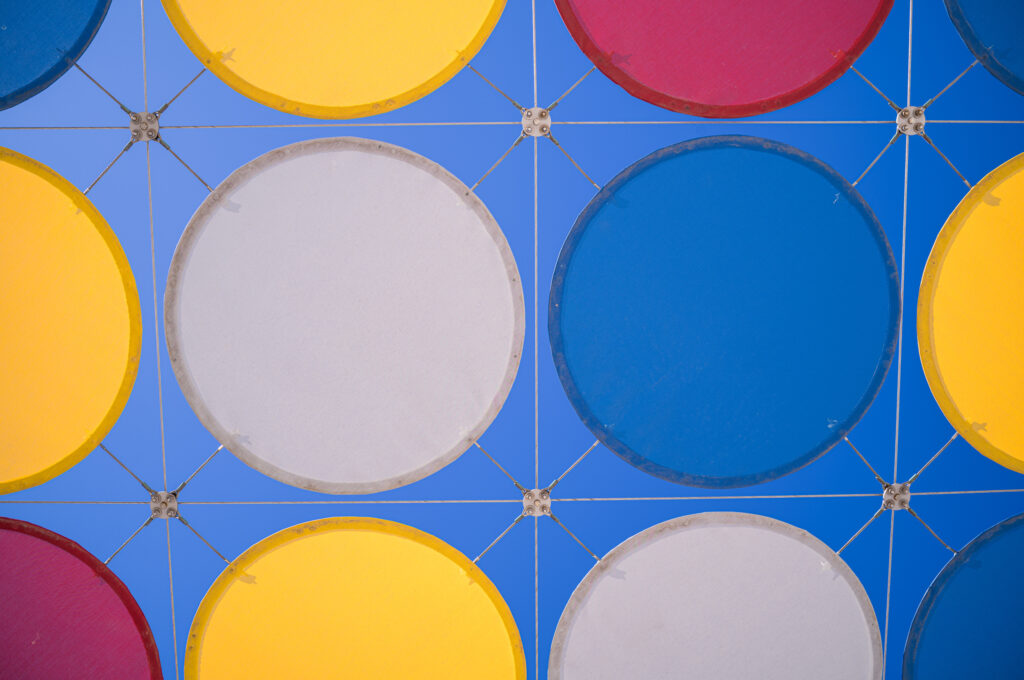Eigentlich wollte ich ihn nie haben. Wirklich nicht!
Ein elektronischer Sucher an einer Leica M, das fühlte sich für mich lange nach einem Stilbruch an. Zu elektronisch, zu wenig „M“. Und dann steht da dieses Ding auch noch oben auf der Kamera und sieht aus… nun ja, darüber reden wir später.
Der Auslöser war am Ende kein plötzlicher Kaufrausch, sondern eher eine leise Kettenreaktion.
Neulich entdeckte ich meinen alten Aufstecksucher für 21 mm. Ein schönes Teil, aber ehrlich gesagt: Ich habe ihn praktisch nie benutzt. Gleichzeitig sah ich, was dafür inzwischen aufgerufen wird. Also wurde er verkauft. Kurz darauf folgten meine alten Canon-Blitze, die seit gut zehn Jahren ungenutzt in der Schublade lagen. Technisch sicher noch okay, praktisch für mich völlig bedeutungslos. Und plötzlich war da Budget. Ohne wirklich „Geld auszugeben“. Ein bisschen addiert, nicht viel draufgelegt und auf einmal war der Visoflex 2 greifbar. Aber das allein hätte nicht gereicht.
Die Sache mit der Naheinstellgrenze
Im letzten Sommer wurde mir etwas immer klarer: Ich nutze die Naheinstellgrenze meines 35er APO erstaunlich oft. Und genau da beginnt das Problem. Bei praller Sonne über das Display im LiveView scharfzustellen ist… sagen wir: suboptimal. Man kneift die Augen zusammen, hält die Kamera irgendwie schattig, verrenkt sich halb und merkt nach einer Weile, dass die Augen einfach müde werden. Richtig müde.
In München hatte ich dann die Gelegenheit, die Leica EV1 auszuprobieren. Und obwohl das ein ganz andere Story ist, blieb der Gedanke eines elektronischen Sucher hängen: Wie wäre das eigentlich an meiner M11-P? Dieser Gedanke ließ mich nicht mehr los.



Gekauft. Und ja: hässlich!
Also habe ich ihn gekauft. Und ich bleibe dabei: Vom Design her finde ich den Visoflex 2 einfach nur grässlich. Er passt optisch so gar nicht zu der klaren, reduzierten Linie einer M. Er ist ein Fremdkörper. Punkt! Aber: technisch ist das Teil hervorragend umgesetzt.
Der Sucher zeigt exakt das gleiche Bild wie das Display im LiveView. Keine Überraschungen, keine Umwege. Was ich hinten sehe, sehe ich auch im Sucher, nur eben dort, wo es bei hellem Licht hingehört: direkt am Auge.
Der Visoflex 2 schaltet sehr zuverlässig ein, sobald man sich mit dem Auge nähert. Kein Gefummel, kein bewusstes Umschalten. Es fühlt sich selbstverständlich an und genau das will man bei einem Zubehör, das man eigentlich nie wollte.
Das Sucherbild selbst ist hervorragend: klar, kontrastreich, gut aufgelöst. Auch feines Scharfstellen im Nahbereich macht damit genau so viel Spaß, wie man es sich erhofft. Oder anders gesagt: Es funktioniert einfach.
Noch kein Langzeittest – aber ein gutes Gefühl
Ich konnte den Visoflex 2 noch nicht ausgiebig testen. Kein Langzeiterlebnis, keine abschließende Bewertung. Aber bisher macht er genau das, was er soll. Unauffällig, zuverlässig, ohne Drama.
Vielleicht ist das am Ende das größte Kompliment.
Ich habe mir etwas gekauft, das ich nie haben wollte.
Ich finde es optisch immer noch nicht schön.
Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich es behalten werde.
Manchmal gewinnt eben die Praxis über die Prinzipien.
Euer Alex